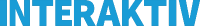Wie muss Medienpädagogik aussehen, um den verschiedenen Herausforderungen einer digital geprägten Gesellschaft gerecht zu werden? Welche Ansätze und Formate fördern digitale Teilhabe und stärken Medienkompetenz nachhaltig? Welche Fragen müssen wir uns stellen in Hinblick auf aktuelle politische Entwicklungen?
Gleichzeitig stehen wir vor neuen Fragen: Wie gehen wir mit Phänomenen wie Desinformation, Hate Speech oder der Macht großer Plattformen um? Welche Chancen und Risiken bringt der Einsatz Künstlicher Intelligenz in Bildungskontexten mit sich? Und wie können wir politische Medienbildung so gestalten, dass sie junge Menschen erreicht und befähigt?
Mit diesen und weiteren Fragen haben wir uns beim Barcamp „Medienkompetenz 2025“ am 30. Juni (14-18 Uhr) im Einstein 28/ MVHS beschäftigt.
Keynote
Gestartet ist das Barcamp mit der Keynote von Dr. Katja Friedrich (Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit), die der Frage nachging, ob wie Medienbildung gesellschaftliche und politische Kontexte stärker in den Blick nehmen kann:
In der öffentlichen Wahrnehmung gilt die Demokratie oftmals als zunehmend gefährdet, wobei soziale Medien eine ambivalente Rolle spielen. Häufig werden vor allem technische Risiken wie Bots oder Deepfakes als Risikofaktor betont, dabei muss die politische Dimension deutlicher in den Blick genommen werden. Auch Medienkompetenz ist entscheidend für politische Teilhabe – sie befähigt Bürgerinnen und Bürger, Informationen kritisch zu hinterfragen. Allerdings führt mehr Medienkompetenz nicht automatisch zu mehr politischem Engagement oder einer Stärkung der Demokratie.
Die Inhalte der Medienpädagogik und der politischen Medienbildung müssten daher über technische Aspekte hinausgehen und verstärkt auch Kommunikationsstrategien, politische Interessen sowie gesellschaftliche Einflussfaktoren thematisieren. Wir müssen die Teilnehmenden unserer Bildungsangebote dazu befähigen, journalistische Inhalte kritisch einzuordnen, politische Absichten zu erkennen und populistische Artikulationen zu analysieren.
Zudem gewinnt der Einsatz von KI in der politischen Kommunikation an Bedeutung – etwa durch Chatbots oder automatisierte Inhalte. Auch hier stellt sich die Frage: Wie politisch gefärbt sind diese Technologien, und wie können wir als Gesellschaft verantwortungsvoll damit umgehen?
Sessions
Im Anschluss an den Vortrag fanden elf Sessions statt, in denen Kleingruppen über verschiedene Ideen und Visionen für eine digitale Gesellschaft diskutiert haben.
Die Dokumentation der Sessions ist hier als PDF-Zusammenfassung zu finden.
Zielgruppe
Das Barcamp richtete sich an alle Fachkräfte aus den Bereichen Bildung, Pädagogik, soziale Arbeit und digitale Teilhabe.
Veranstalter
Das Barcamp wurde veranstaltet von „Interaktiv“, dem Münchner Netzwerk Medienkompetenz, das im Auftrag der städtischen Referate für Soziales, Bildung und Kultur agiert.
Kooperationspartner:
- Münchner Volkshochschule
- Referat für Bildung und Sport der LH München
Was ist eigentlich ein Barcamp?
Ein Barcamp ist eine offene Tagung mit Workshops und lebt von der aktiven Mitgestaltung aller Beteiligten. Durch den Austausch von Erfahrung und Wissen können neue Ideen entstehen und Projekte gemeinsam gestartet werden.
Ein Barcamp bedeutet, dass alle Teilnehmenden selbst die Themen vorschlagen, an denen gearbeitet werden soll. Die Themengebiete und -vorschläge werden bereits bei der Anmeldung über das Online-Formular erfasst und am Veranstaltungstag vor Ort zur Sessionplanung zusammengefasst.
Die Themen und Ideen werden dann in Form von je 45-minütigen Sessions aufgegriffen. Alle Teilnehmenden können ihre Themen selbst moderieren und durch die Session führen.
Ein gutes Video zum Format “Barcamp” ist hier zu sehen.